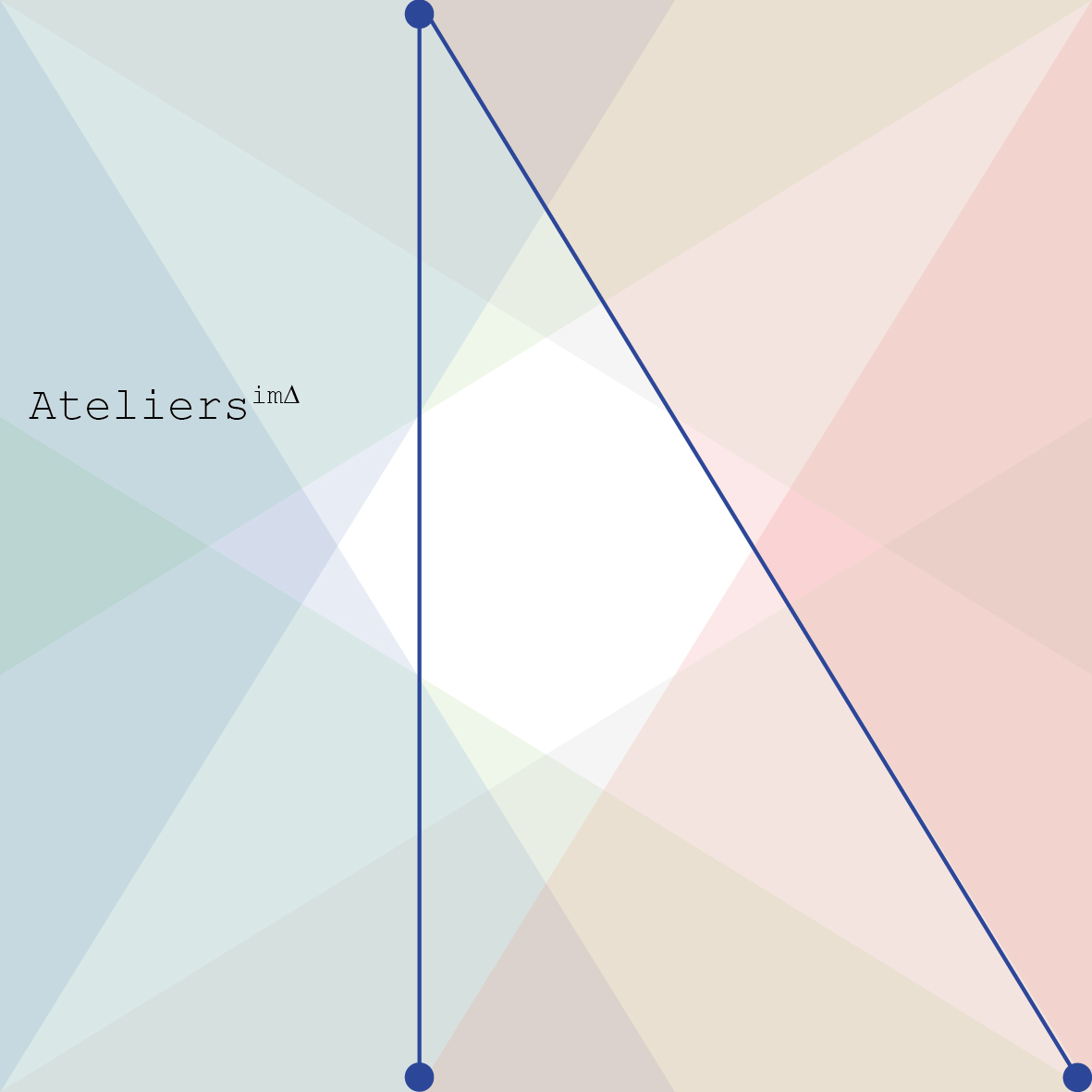Ralf Jochen Moser
Mein Leben als Künstler
Wer mich fragt, was ich am liebsten geworden wäre, dem antworte ich: Ingenieur – nicht aus Berufung, sondern aus Prinzip. Denn mein Antrieb ist die ständige Weiterentwicklung. Ich denke wie ein Architekt, forsche wie ein Wissenschaftler, bilde Modelle wie ein Mathematiker, frage wie ein Philosoph und vernetze wie ein Kybernetiker. Grenzen interessieren mich nur, um sie zu überschreiten. Freiheit bedeutet für mich, nicht zu fragen, was andere denken – sondern zu tun, was ich denke. Vielleicht ist genau das die Rolle des Künstlers in mir.
Auf meiner Künstlerseite dokumentiere ich umfassend meine Werke und Veröffentlichungen. Hier präsentiere ich eine Auswahl jener Arbeiten, die ich für Sammlerinnen und Kunstliebhaberinnen als besonders interessant und sammelwürdig einschätze.
- Hier findet sich:
- Auf meiner Künstlerseite findet sich:

Künstlerstatement
Meine Kunst untersucht als Metakunst, wie Idealisierungen, Einflussnahmen und andere normative Kontexte in Gemeinschaften die persönliche Entscheidungsfreiheit im Namen von Kunst, Kultur, Wissenschaft und Glauben in jenen Bereichen einschränken, die in Demokratien der persönlichen Entscheidungsfreiheit unterliegen.
Zusammen mit meiner Tochter Hannah S. Moser habe ich ein gemeinsames Lebensprojekt „Carpe Diem et Noctem – Zettelwirtschaft für Lebenskrisen“ als Kunstprojekt initiiert. Mit einer eigens entwickelten Systematik ordnen wir jene Lebensbereiche, in denen kulturelle, wissenschaftliche und religiöse Idealisierungen durch Kunst-, Kultur-, und Wissenschaftstheorien sowie durch religiöse Metaethiken unsere Freiheit beeinflussen. Doch statt Antworten zu geben, schaffen wir Lehren, die das Ich stärken – gegen das Wir, wenn nötig. Lehren zeigen Möglichkeiten ohne Einflussnahme auf und bieten eine Hilfestellung für eigene Lebensprojekte.
Unsere meditative Kunst stellt dazu zentrale Fragen, ohne normativ Einfluss auf die Antworten zu nehmen. Beispiele sind: „Wer möchte ich sein?“, „Wie möchte ich mit Liebe, Lust und Leidenschaft in Partnerschaften, Freundschaften und Liebschaften umgehen?“ und „Wie stelle ich, das Problem meiner Kunst auf?“. Unsere Kunst ermöglicht Theorien in Lehren zu transformieren, die das Wir und die Einflussnahmen in Theorien zugunsten des Ichs und seiner Entscheidungsfreiheit in Lehren zurückdrängen.
Ausgewählte Werke
Eine Erkenntnislehre der Liebe (EEdL)
Das Thema ist vermutlich so alt wie das Leben. Spätestens seit der Erfindung von zweigeschlechtlichen Keimzellen spannt es den Raum zwischen himmelhoch Jauchzend und zu Tode betrübt auf. Wir nehmen das Thema als Lehre auf und spüren der Liebe und seiner Verbindung zum Leben als Erkenntnis- und Wissenschaftslehre einerseits und der Kybernetik andererseits nach. Dabei ist Lehre in Erkenntnis- und Wissenschaftslehre mehr als ein Wort. Es unterscheidet das technologische Weltbild einer kybernetischen Techne, in dem der Glaube durch unsere Beobachtungen und unser Wissen begrenzt wird, von dem idealisierenden Weltbild mit ihren Erkenntnis-, Wissenschafts-, Kultur-, Kunst- und Sozialtheorien. Seinen Anfang hat die Liebe im Heiligen und seinen idealistischen Wurzeln. Damit wird auch alles relevant, was das Heilige in den alten Religionen umgibt: ihre Götter, ihre Magie, ihre Opfergaben, ihre heiligen Orte, ihre heiligen Rituale und seit der Erfindung der sumerischen Keilschrift auch ihre heiligen Schriften.
EEdL-Radar Love
In „EEdL-Radar Love“ geht es darum, wie wir mit Liebe, Lust und Leidenschaft in Partnerschaften, Freundschaften und Liebschaften umgehen und dass wir sogar in der Rockmusik nicht den Idealisierungen rund um die Liebe entkommen. „Radar Love“ von Golden Earring ist ein Rocksong aus dem Jahr 1973, der sich durch seinen treibenden Rhythmus, eine markante Basslinie und eine epische Gitarrenarbeit auszeichnet. Er gilt als Klassiker des Hard Rock und wurde besonders in den USA ein großer Hit.
Der Song erzählt die Geschichte eines Mannes, der sich auf eine nächtliche Autofahrt begibt, um zu seiner Geliebten zu gelangen. Obwohl sie räumlich getrennt sind, fühlen sie sich durch eine Art „telepathische Verbindung“ miteinander verbunden – die sogenannte Radar Love. Diese Verbindung erlaubt es ihnen, Gedanken und Gefühle über große Entfernungen hinweg zu teilen.








Der Fahrer spürt, dass seine Geliebte ihn ruft, und er fährt mit hoher Geschwindigkeit durch die Nacht, begleitet von Musik im Radio und dem Rhythmus der Straße. Die Lyrics vermitteln ein Gefühl von Sehnsucht, Geschwindigkeit und einer fast mystischen Verbindung zwischen zwei Liebenden.








In der letzten Strophe von „Radar Love“ wird angedeutet, dass die Verbindung zwischen dem Fahrer und seiner Geliebten sogar über den Tod hinaus besteht. Der Song beschreibt, wie der Fahrer immer schneller fährt, weil er den Ruf seiner Geliebten spürt. Schließlich kommt es zu einem Unfall – der Fahrer stirbt. Doch selbst nach seinem Tod bleibt die „Radar Love“ bestehen: Die Geliebte spürt weiterhin seine Präsenz, als würde ihre Verbindung nicht durch den Tod getrennt werden. Die Lyrics deuten an, dass Liebe und Sehnsucht eine Art übernatürliche, unzerstörbare Verbindung schaffen, die selbst den Tod überdauert.








Schwäne gelten in vielen Kulturen als Symbol für Treue und ewige Liebe, weil sie sich meist nur einmal im Leben einen Partner wählen und diesem treu bleiben. Diese lebenslange Bindung fasziniert uns Menschen, weil sie ein Ideal widerspiegelt, das wir uns auch für unsere eigenen Beziehungen wünschen: Beständigkeit, Verlässlichkeit und eine tiefe, unerschütterliche Verbindung. In einer Welt, in der Beziehungen oft von Unsicherheiten und Veränderungen geprägt sind, erscheint die Vorstellung einer einzigen, alles überdauernden Liebe besonders tröstlich und erstrebenswert. Schwäne werden so zu Projektionsflächen für unsere Sehnsucht nach einer Liebe, die Zeit und sogar den Tod überdauert – ähnlich wie es in „Radar Love“ beschrieben wird. Die Treue der Schwäne steht für das Versprechen, dass wahre Liebe nicht vergeht, sondern bleibt – unabhängig von äußeren Umständen. Deshalb idealisieren wir solche Verbindungen und erzählen Geschichten darüber, in denen Liebe stärker ist als alles andere.
Obwohl Schwäne oft als Inbegriff lebenslanger Treue gelten, entspricht dieses Ideal nicht immer der Realität. Auch bei Schwänen gibt es Trennungen, Neuverpaarungen und sogar gleichgeschlechtliche Paare. Besonders bemerkenswert ist, dass in vielen Populationen männliche Schwanenpaare gemeinsam Nester bauen und manchmal sogar gemeinsam Jungtiere aufziehen – ein Phänomen, das lange Zeit verschwiegen oder tabuisiert wurde, etwa auch in Schweden. Solche Beobachtungen zeigen, dass die Natur vielfältiger ist, als es unsere romantischen Vorstellungen oft zulassen. Die Idealisierung der „ewigen Liebe“ bei Schwänen blendet diese Vielfalt aus und spiegelt eher menschliche Sehnsüchte wider als biologische Realität. Gerade deshalb lohnt es sich, genauer hinzuschauen und die Komplexität von Beziehungen – bei Tieren wie bei Menschen – anzuerkennen.
Die Natur kennt Vielfalt – vielleicht sind Schwäne da ehrlicher als unsere romantischen Ideale. Wir hängen oft an der Vorstellung von ewiger Liebe, während die Natur längst zeigt, dass echte Verbindung, Freiheit und Vielfalt viele Formen haben können. Schwäne machen’s vor – aber auch sie leben nicht immer nach dem Ideal. Am Ende sollten wir unsere Beziehungen so gestalten, wie sie zu uns passen. Viele Menschen wünschen sich offene oder alternative Beziehungsformen – auch das ist Vielfalt, selbst wenn sie nicht von Schwänen vorgelebt wird.
Eine Erkenntnislehre des Heiligen (EEdH)
EEdH – Heilige Orte als Wegweiser der Menschheitsentwicklung
Heilige Orte markieren Wendepunkte in der Geschichte des Menschen – vom Aufstieg zur „Krone der Schöpfung“ bis hin zum Fluch den die Menschheit über die Welt bringt, sich die Ökosysteme zu unterwerfen. Die Erkenntnislehre des Heiligen war zu Beginn eng mit jener der Zivilisation verflochten. Ihr Ursprung liegt im Übergang zur Sesshaftigkeit und Landwirtschaft – einem epochalen Wandel, den die Megalithkultur maßgeblich prägte.
Ein möglicher Ausgangspunkt dieser Entwicklung war der erste heilige Hügel: Göbekli Tepe. Der Archäologe Klaus Schmidt (1953–2014) stellte die Hypothese auf, dass es sich um ein steinzeitliches Bergheiligtum handelte – einen Ort, an dem erstmals verschiedene Jägergruppen zusammenkamen, um eine rituelle Begegnungsstätte zu errichten. Aus dieser kultischen Kooperation erwuchs eine neue Lebensweise: Die Jäger begannen, das wild wachsende Getreide am Berg gegen tierische und menschliche Konkurrenten zu verteidigen. So entstanden Ackerbau und Viehzucht – nicht als technologische Innovation, sondern als Folge einer spirituellen Praxis.
EEdH – Heilige Grabanlagen der Megalith-Kultur
In der Wildeshauser Geest vollzog sich der Übergang zur Landwirtschaft zwischen etwa 3500 und 2800 v. Chr. Diese Entwicklung ist vor allem ein Verdienst der Trichterbecherkultur (TBK), die zugleich die nordische Megalitharchitektur hervorbrachte. In dieser Region wurde das Heilige zunehmend mit den Ahnen und dem Jenseits verknüpft. Die Megalithanlagen zeugen von einer spirituellen Weltdeutung, in der die Verbindung zu den Verstorbenen und zur jenseitigen Welt im Mittelpunkt stand. Anders als in Göbekli Tepe, wo das Heilige den Beginn agrarischer Kultur markierte, wurde in der Geest das Heilige nicht zur Grundlage von Produktion, sondern zur Bewahrung von Herkunft und Transzendenz. Die Steine wurden nicht nur gesetzt, um zu kultivieren, sondern um zu erinnern – an die Toten, an die zyklische Ordnung der Natur und an die unsichtbare Welt jenseits des Sichtbaren.




EEdH – Portale in die Anderswelt
Der Donnersberg, mit 687 Metern die höchste Erhebung der Pfalz, war vor über 2.000 Jahren ein bedeutendes Zentrum der keltischen Latènekultur. Auf seinem Plateau errichteten die Kelten eine der größten befestigten Stadtanlagen nördlich der Alpen – ein sogenanntes Oppidum, das sich über 240 Hektar erstreckte und von einem 8,5 Kilometer langen Ringwall umgeben war. Im Nordosten des Oppidums liegt der geheimnisvolle Schlackenwall, ein hufeisenförmiges Monument, in dessen Umgebung durch hohe Hitze verschlackter Rhyolith gefunden wurde. Archäologen vermuten, dass hier Glas hergestellt wurde – ein Material, das in keltischer Symbolik oft mit Übergängen zwischen den Welten assoziiert wird. Die Form und Lage des Schlackenwalls sowie seine Verbindung zu Feuer und Transformation lassen Raum für Interpretationen: War dies ein Ort ritueller Übergänge? Ein Tor zur Anderswelt, wie es in keltischer Mythologie häufig beschrieben wird?




Die Kelten glaubten an eine durchlässige Grenze zwischen der sichtbaren Welt und der Anderswelt, einem Reich der Geister, Ahnen und Götter. Orte wie der Donnersberg – hoch gelegen, von Nebel umhüllt und mit kultischen Anlagen versehen – galten als besonders geeignet für den Kontakt mit dieser anderen Realität. Überall finden sich heilige Orte, die heilige Symbole, Portale und Übergänge in eine andere Welt markieren.
EEdH – Heilige Berge
Der Donon, mit 1009 Metern einer der höchsten Gipfel der Vogesen, war seit der Jungsteinzeit ein bedeutender Kultort. Die Kelten verehrten hier Götter wie Teutates, Vosegus (Namensgeber der Vogesen) und Taranis, den Himmels- und Donnergott. Der Berg war ein spirituelles Zentrum für Stämme wie die Triboken, Mediomatriken und Leuken. Besonders auffällig sind die Schalensteine, Menhire und energetischen Schwellen entlang der alten Pilgerpfade. Der Donon galt als Ort der Verbindung zwischen Himmel und Erde – ein Portal zur Anderswelt. Die Römer übernahmen diesen Kultort und errichteten gallo-römische Tempel, insbesondere zu Ehren von Merkur, dem sie mit dem keltischen Teutates gleichsetzten.




Der sogenannte Teufelsstein bei Bad Dürkheim ist ein eindrucksvoller Opferstein aus keltisch-germanischer Zeit. Er weist eine Mulde mit Blutrinne und eingemeißelte Stufen auf – deutliche Hinweise auf rituelle Opferhandlungen. In der Umgebung befinden sich weitere bedeutende keltische Stätten wie die Heidenmauer, eine frühkeltische Stadtanlage mit Ringwall, und das Fürstengrab von Bad Dürkheim, das etruskische Luxusgüter enthielt – vermutlich diplomatische Geschenke. Die Römer verdrängten die Kelten nicht nur militärisch, sondern auch kulturell. Sie übernahmen deren heilige Berge und errichteten dort Tempel für ihre eigenen Götter – oft in Synkretismus mit keltischen Gottheiten. So wurde Merkur mit Teutates gleichgesetzt, Jupiter mit Taranis. Am Donon finden sich Reste mehrerer gallo-römischer Tempel, Stelen und Votivbilder. Die Römer nutzten die spirituelle Kraft dieser Orte, um ihre Religion zu verankern und die lokale Bevölkerung zu integrieren.
Auch auf dem Heiligenberg in Heidelberg lässt sich der Wandel der Kulturen eindrucksvoll nachvollziehen:
Zunächst errichteten die Kelten im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. eine mächtige Höhensiedlung mit doppeltem Ringwall, die als politisches, religiöses und kulturelles Zentrum der Region diente. Die Überreste dieser Ringmauern sind bis heute im Gelände sichtbar und können auf dem Keltenweg erkundet werden. Mit der Ankunft der Römer wurde der Heiligenberg weiterhin als heiliger Ort genutzt: Sie errichteten auf den Fundamenten der keltischen Siedlung einen Tempel zu Ehren von Jupiter, dem obersten Gott des römischen Pantheons, der häufig mit dem keltischen Donnergott gleichgesetzt wurde. Im Mittelalter schließlich entstand auf dem Heiligenberg ein christliches Kloster (die Michaelsbasilika und das Stephanskloster), das die spirituelle Bedeutung des Ortes in neuer Form weiterführte. So ist der Heiligenberg ein einzigartiges Beispiel für die Überlagerung und Transformation von Kultorten: von der keltischen Siedlung über den römischen Tempel bis zum christlichen Kloster.
Wegweiser für kluge Avantgardisten
Die Wandelhallen des ewigen Donners
Über Gott, das Leben und die Welt nachzudenken, scheint gut mit Umherwandeln und Spazierengehen einher zu gehen; aber wo wandelt der moderne Mensch in der modernen Stadt umher, wenn er zum Philosophieren aufgelegt ist? Schon seit meiner Kindheit gehe ich zum Philosophieren in den Wandelhallen des ewigen Donners spazieren. Die großen Mannheimer Brücken überqueren die Mannheimer Flüsse und Kanäle und eignen sich als moderne Wandelhallen für den philosophischen Dreikampf: Spazieren, Philosophieren und Fotografieren.




Für mich sind sie die Wandelhallen des ewigen Donners, weil dort der Mannheimer Verkehr für immer und ewig zu donnern scheint. Peripatos ist die griechische Übersetzung von Wandelhalle. Peripatos ist auch der Name der philosophischen Schule des Aristoteles und so haben alle angesprochenen Themen einen direkten oder indirekten Bezug zu Aristoteles Philosophie. Und der Peripatos ist ein Spazierweg unterhalb der Akropolis in Athen und so spielt auch das Spazierengehen eine große Rolle. Mit dem Bild 12 M hat am 24. Mai 2010 alles begonnen und mit dem Bild Wer wird den wohl die Tür verfehlen war der aristotelische Kontext gesetzt und die Idee der Wandelhallen geboren.




Eigentlich wollte ich die Wandelhallen des ewigen Donners auf meine Brücken in Mannheim beschränken. Im Jahr 2013 kamen dann die Frankfurter Brücken dazu und 2016 habe ich in Leipzig mit Bullshit die Holzwege politischer Vernunft begonnen. In Leipzig, rund um das MDR Hochhaus und den Augustus Platz, gibt es zwar Brücken zwischen Gebäuden und auch (Konzert-)Hallen, aber es ist nur sehr bedingt mit den klassischen Wandelhallen vergleichbar.




Am Ende wird aber Bleiben, dass alle Bilder der Wandelhallen beim Spazierengehen und Nachdenken über philosophische Themen entstanden und die Orte mit einem narrativen Kontext belegt werden, der zu den Wandelhallen passt. Die Wandelhallen stehen so als Sinnbild für jene Zusammenhänge, um die es in der Fotoserie geht. Es wäre aber albern einen direkten Zusammenhang zwischen den Bildern der Fotoserie und philosophischen Idee, Zitaten und Gedanken herstellen zu wollen und doch ergibt sich ein sehr persönlicher Zusammenhang beim Umherwandeln, Verweilen, Fotografieren, Nachdenken und Verstehen. Dieser Zusammenhang bildet den narrativen Kontext der Wandelhallen
Biografisches
Ich wurde 1960 in Mannheim geboren, bin dort aufgewachsen und habe auch in meiner Heimatstadt studiert: Kybernetik, Wirtschaftsinformatik und Wissenschaftslehre – ein Teilgebiet der modernen Philosophie. Seit 1988 entwickle ich Software. Zunächst bei der SAP GmbH, später bei der SAP AG und dann bei der SAP SE. Meine Berufsbezeichnung stammt noch aus den 1980er Jahren: Systemanalytiker.
Heute bin ich seit vielen Jahren als Architekt tätig – nicht im technischen Sinne, sondern im übertragenen: als Gestalter von Architekturen und Ideen, Konstruktionen und ihren technischen Zusammenhängen, sowie ihren Umsetzungen in der realen Welt.
In mir steckt seit jeher ein Künstler – aber auch ein kreativer Architekt, Konstrukteur und Ingenieurwissenschaftler, der nach besseren Wissenschafts- und Konstruktionslehren strebt. Als sich 2009 abzeichnete, dass meine Tochter Hannah Kunst studieren würde, gründeten wir gemeinsam die Ateliers im Delta. Seitdem beschäftigen wir uns intensiv mit Fotografie, Medienkunst, Metakunst, Metametakunst und Metalogen. Was einst als gemeinsames Projekt begann, ist längst zu einem zentralen Bestandteil meines Lebens geworden.
Mehr Informationen finden sich auf meiner Künstlerseite und meinem Kommentierten Lebenslauf
Einzel- und Gruppenausstellungen
2025 (G) Natur unter Druck, Künstlerbund Rhein-Neckar, xylon – Museum Schwetzingen
2025 (G) Extended Zen, Giftbox
2025 (G) Zen 42, Giftbox
2024 (G) AiD ART M, Raum S4 17, alte Stadtgalerie Mannheim
2024 (G) „SQUARE OF OPPOSITION“ in der Galerie Hafemann, Wiesbaden
2023 (G) Stand der Dinge, Künstlerbund Rhein-Neckar, Rosengarten Mannheim
2023 (G) Bitburg Art, Bitburg
2022 (G) Die Metaebenen des Geistes, des Lernens, der Kunst und des Lebens, Giftbox
2022 (G) Discovery Art Fair, Köln
2021 (S) Das Herstellen des Heiligen, Giftbox
2020 (G) Discovery Art Fair, Frankfurt
2019 (G) Discovery Art Fair, Frankfurt
2019 (G) Discovery Art Fair, Köln
2018 (G) Discovery Art Fair, Frankfurt
2017 (G) Eden, Organisation der Ausstellung, 11 Künstler im Abbruchhaus Ludwigshafen
2016 (G) Mein christliches Testament, 5 Jahre Breidenbach, Heidelberg
2014 (S) Die Wandelhallen des ewigen Donners, Ausstellung und Talk Fotografie